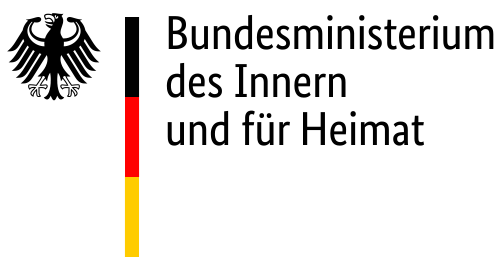Die Tagung des Theologischen Forums Christentum – Islam 2025 widmete sich den vielschichtigen Beziehungen zwischen Judentum, Christentum und Islam. Christian Ströbele, Leiter des Fachbereichs Interreligiöser Dialog, betonte in seiner Begrüßung die Dringlichkeit des Themas, insbesondere angesichts der aktuellen gesellschaftspolitischen Lage. Er unterstrich die Notwendigkeit der Einbeziehung jüdischer Perspektiven und verwies auf den kooperativen Ansatz des Forums, der ein „side-by-side“ Engagement anstrebe, inspiriert vom Programm des Rabbiners Jonathan Sacks und erinnerte an das Leitprinzip des Forums, die jeweils „eigene Traditionen selbstkritisch zu reflektieren, Positionen der je anderen Religion zu verstehen und Konsens wie Differenz gleichermaßen Raum zu geben“.
Judentum aus der Perspektive christlicher und islamischer Theologie
Prof. Anja Middelbeck-Varwick (Universität Frankfurt a. M.) führte in die thematischen Schwerpunkte ein und erläuterte, inwiefern die Konstruktion und Reflexion des Judentums in christlichen und muslimischen Traditionen im Mittelpunkt der Fragehorizonts der Tagung stehen. Dabei gehe es sowohl um eine historische Betrachtung wechselseitiger Bezugnahmen, wie auch um die Frage, wie diese Beziehungsgeschichten das Selbstverständnis und die theologische Entwicklung der jeweiligen Religion bis heute prägen und theologisch zu begreifen und weiterzuentwickeln sind.
Prof. Armina Omerika schilderte besonders die Bedeutung und Komplexität der Beziehungen zwischen Judentum und Islam, die durch den Nahostkonflikt, insbesondere seit dem 7. Oktober 2023, überschattet werden. Religionen seien „keine statischen Gebilde“, sondern „dynamische Konstruktionen“, die sich in einem fortwährenden Prozess der „Co-Konstruktion“ befänden. Sie betonte die Gleichzeitigkeit von Kooperation und Konflikt in der Geschichte dieser Religionen und warnte vor essentialistischen Betrachtungsweisen. Stattdessen brauche es eine „radikale Historisierung der Positionen“, um die Bedingungen und Möglichkeiten der Entwicklung theologischer Positionen zu verstehen.
Dr. Edward Kessler, Gründungspräsident des Woolf Institute in Cambridge, sprach in seinem Vortrag „Theological Challenges in Jewish-Muslim-Christian Relations“ über die Herausforderungen in den jüdisch-muslimisch-christlichen Beziehungen. Er zitierte Levitikus 19,34, um die Bedeutung der Nächsten- und Fremdenliebe sowie des Dialogs zu unterstreichen: „Der Fremdling, der bei euch wohnt, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst.“ Kessler betonte die Notwendigkeit eines echten Dialogs, der auf gegenseitigem Respekt, dem aufrichtigen Interesse am Anderen und dem Verständnis des Anderen in seiner Andersartigkeit beruhe – „embracing the dignity of difference“, wie Jonathan Sacks es formuliert hat. Er stellte das Konzept des jüdischen Bundespluralismus vor, das eine theologische Grundlage für interreligiösen Dialog biete. Er verwies auf die jüngst vereinbarten „Muslim-Jewish Reconciliation Accords“ im Vereinigten Königreich als wichtigen Meilenstein, der zeige, dass trotz aller Schwierigkeiten Fortschritte möglich seien.
In der anschließenden Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern ein solches Abkommen in historischen Linien steht, die die muslimisch-jüdischen Beziehungen viel grundlegender prägen als der Nahostkonflikt, und ob es nicht einer stärkeren historischen Kontextualisierung bedürfe. Kessler antwortete, dass es „eine besondere europäische Erfahrung“ der jüdisch-muslimischen Beziehungen gebe, da beide Gemeinschaften in Europa Minderheiten seien. Er betonte, dass Religion sowohl Teil des Problems als auch der Lösung im Nahen Osten sein könne und müsse: “Religion is not only contributing to the problem it has to contribute to the solution.” Kessler hob hervor, dass es bei den Verhandlungen zu den „Accords“ keine theologischen Einwände gegen eine Verständigung zwischen Juden und Muslimen gegeben habe.
Prof. Stefan Schreiner beleuchtete „Schauplätze der Be- und Vergegnung in den Beziehungen zwischen Juden, Christen und Muslimen“. Er zeigt auf, dass zuvorderst die historischen Erfahrungen und sozialen Interaktionen und nicht erst die Theologie die Beziehungen zwischen diesen Religionen prägen: Die Theologie habe oftmals dann die Rolle, Entwicklungen erst im Nachhinein erklären zu müssen. Unter der Vielzahl von „Schauplätzen“ der Begegnung ging Schreiner ein auf Handelsrouten und Reiseberichte wie diejenigen von Benjamin von Tudela, Ibn Fadlan oder Abu Hamid al-Gharnati, die eine schier unerschöpfliche Quelle für das Verständnis interreligiöser Beziehungen darstellen, aber auch Verzerrungen und Fälschungen vorstellten. Weitere von Schreiner beleuchtete Schauplätze umfassten die arabische Halbinsel, Afghanistan als Zentrum der Gelehrsamkeit im 8.-12. Jahrhundert, und auf das Chasarenreich. Er betonte, dass die archäologischen Funde in Saudi-Arabien das Bild der Frühgeschichte des Islam verändern und hob die Rolle der Sprache als Begegnungsort hervor und illustrierte, dass Spaltungen innerhalb von Religionsgemeinschaften oft entlang von Sprachgrenzen verliefen. Schreiner betonte die Komplexität und Vielschichtigkeit der Beziehungen und die Notwendigkeit, sowohl Begegnung als auch Abgrenzung zu berücksichtigen.
In der Diskussion wurde die Bedeutung von Alltagsgeschichten und der Erforschung von Nachbarschaftsbeziehungen hervorgehoben. Omerika merkte an, dass theologische Vorstellungen durchaus Einfluss auf die Gestaltung von Gesellschaften und die „Topographie des Religiösen“ haben könnten.
Interreligiöse Hermeneutik zwischen Judentum, Christentum und Islam
Nach dem programmatischen und historisch-theologischen Auftakt folgte eine Sektion zu Methodenfragen, Exemplifikationen und Implikationen interreligiöser Hermeneutik mit Farid Suleiman, Katharina Heyden und Reuven Firestone.
Dr. Farid Suleiman, Dozent für Islamische Theologie an der Universität Greifswald, setzte mit einem Zitat von Ludwig Wittgenstein ein: „Don’t think, but look!“ Dies könne auch als Aufforderung für interreligiöse Hermeneutik gelten. Denn religiöse Ideen würden eher von metaphysischen Rahmenkonstrukten überformt gesehen, anstatt die tatsächlich vollzogene Praxis voranzustellen und ihren Gebrauchssinn zu erschließen. Dem könne man Wittgensteins Selbstbeschreibung zuordnen, seine eigenen Gedanken seien zu „hundert Prozent hebräisch“ statt „griechisch“ geprägt: Es gehe ihm, so gelesen, weniger darum, zu klären, was Gott ist, und seine Beziehung zur Schöpfung ontologisch zu definieren, als in den Mittelpunkt zu stellen, wer Gott ist und wie seine Beziehung zur Schöpfung in ethischer Hinsicht aussieht wie dies menschliches Handeln prägt. Das verstärke und spezifiziere die Notwendigkeit einer Kontextualisierung von Hermeneutik. Als Fallbeispiel diskutierte er, wie koranische Texte gelesen werden können im Kontext spätantiker Debatten über Theosis: Man könne diese Passagen als kritische Positionierung zu kursierenden Verständnissen von Theosis lesen – was in der traditionellen und modernen Koranexegese und modernen Forschung ein Novum darstellen würde. Anhand spätantiker, vorislamischer Debatten über Theosis, insbesondere im Judentum und Christentum, rabbinischer Texte und christlicher Kirchenväter, skizzierte Suleiman die unterschiedlichen Verständnisse von Theosis und deren Verbindung zur Inkarnation. Dagegen stelle der Koran ein Menschenbild, das dem Gedanken einer Vergöttlichung des Menschen entgegen stehe.
Prof. Katharina Heyden, Professorin für Ältere Geschichte des Christentums und interreligiöse Begegnungen an der Universität Bern, sprach über „Verflochtene Geschichten und die Co-Produktion von Judentum, Christentum und Islam“. Sie betonte die Bedeutung der Geschichte für die Gestaltung religiöser Traditionen und stellte das Konzept der „koproduzierten Religion“ vor: Judentum, Christentum und Islam haben sich demnach durch Interaktion, Reflexion und Imagination gegenseitig geformt und transformiert. Dazu präsentierte sie zwei Fallbeispiele, die Figur des Bahia/Sergius und die Geschichte von Joseph, dem Sohn Jakobs. Bahia/Sergius ist eine Figur, die sowohl in islamischen als auch in christlichen Traditionen vorkommt, jedoch mit unterschiedlichen Interpretationen. In der islamischen Tradition ist er ein christlicher Mönch, der Muhammad als Propheten erkennt, während er in der christlichen Tradition oft als Häretiker dargestellt wird, der den Koran beeinflusst habe. Die Geschichte von Joseph ist ein Beispiel für eine biblische Erzählung, die in Judentum, Christentum und Islam rezipiert und unterschiedlich interpretiert wurde, wobei jede Tradition ihre eigene theologische Deutung entwickelte. Heyden schloss mit der Frage, wie Theologie den Ansatz der Verflechtung integrieren kann, um die gegenseitige Abhängigkeit und Beeinflussung der drei Religionen besser zu verstehen. Sie betonte die Notwendigkeit, sich der ambivalenten Potentiale bewusst zu sein, die durch die Koproduktion entstehen, und die Bedeutung der Anerkennung dessen, was die Religionen „owe to each other“; also einander sowohl verdanken als auch schulden.
Prof. Reuven Firestone, Professor für mittelalterliches Judentum und Islam am Hebrew Union College, sprach über die Geschichte der Beziehungen zwischen den drei abrahamitischen Religionen. Er betonte deren Bedeutung für das Verständnis interreligiöser Beziehungen und stellte fest, dass neue Religionen oft als Bewegungen beginnen und Muster der Beziehung zu den Religionen entwickeln, aus denen sie hervorgegangen sind. Er beschrieb die Entwicklung vom Polytheismus zum Monotheismus im alten Israel und die damit verbundene Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Religion, wie sie Jan Assmann als „mosaische Unterscheidung“ bezeichnet. Diese Unterscheidung habe die interreligiösen Beziehungen grundlegend verändert hat, da sie anstelle eines Nebeneinanders pluraler Verehrungen von Gottheiten den Wettbewerb zwischen den Religionen um die wahre Interpretation des einen Gottes eröffnete. Rabbi Firestone analysierte die Entstehung des Christentums und des Judentums als neue religiöse Bewegungen im Ausgang vom spätantiken Judentums. Nachdem zunächst das Judentum als fortdauernde Bedrohung wahrgenommen wurde, änderte der Islam die „Nullsummenbeziehung“ zwischen Judentum und Christentum: Er brach diese auf, indem er als dritte erfolgreiche monotheistische Religion auftrat. Maßgeblich dafür sei, dass der Koran gerade nicht beanspruche, Judentum und Christentum zu ersetzen, sondern sich als eine bessere Version des Monotheismus präsentiere. Firestone schloss mit der Feststellung, dass wir alle Geprägte unserer Geschichte und unserer unzureichenden Wahrnehmungen sind. Er plädiert daher für Bescheidenheit und Offenheit gegenüber anderen religiösen Traditionen, auch wenn sie uns fremd erscheinen.
Die Hebräische Bibel: Text, Deutung, Wirkung
Auf diese hermeneutisch und religionstheologisch grundlegende Sektion folgte ein Panel zu „Lesarten, Konstruktionen und Normativitäten der Hebräischen Bibel“ mit Prof. Zishan Ghaffar (Universität Paderborn), Prof. Ulrike Bechmann (Universität Graz) und Rabbinerin Prof. Birgit Klein (Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg).
Ghaffar strukturierte seinen Beitrag zu koranisch-theologischen Perspektiven auf Tora und Schriftauslegung um zwei grundlegende Fragen: Welche Autorität und welcher hermeneutische Interpretationsrahmen wird heiligen Schriften aus koranischer Perspektive zugestanden, und welche hermeneutischen Prinzipien sind für den interreligiösen Dialog maßgeblich? Ghaffar verwies zunächst auf Sure 5,44, wo das Verhältnis des Korans zur Tora thematisiert wird: „Wir haben die Thora herabgesandt, die in sich Rechtleitung und Licht enthält. Die Propheten richteten danach […] Und so taten es die Rabbiner und Gelehrten.“ Mit Rückgriff auf die Forschung von Holger Zellentin zeigte Ghaffar, dass der Koran die rabbinische Auslegungskompetenz grundsätzlich anerkennt, jedoch eine kritische Position zur rabbinischen Hermeneutik einnimmt.
Während im rabbinischen Verständnis Rabbinen beauftragt sind, „durch ihre kreative und harmonisierende Auslegung einen Schutzzaun um die Tora zu errichten“, ziehe der Koran eine Grenze: Die Auslegung dürfe nicht dazu führen, dass der ursprüngliche propositionale Gehalt der Schrift suspendiert werde. Am Beispiel des Talionsrechts erläuterte Ghaffar: „Der Koran gesteht zwar zu, das körperliche Talionsrecht in individuellen Fällen durch Vergebung auszusetzen […], doch verbietet der Koran gleichermaßen sowohl den Juden als auch den Christen, die körperliche Anwendbarkeit des biblischen Rechts ganz und gar außer Kraft zu setzen.“
Einen zentralen Teil seiner Analyse bildete das koranische Konzept des „taḥrīf“, der „Verfälschung“, das im Koran viermal vorkommt. Ghaffar bezog dieses Konzept nicht auf die religionspolitische Anwendung späterer Zeiten, sondern als Hinweis auf ein schrifthermeneutisches Problem, das sich auf konkrete Auslegungspraktiken bei Juden und Christen bezieht: Problematisch ist dabei aus koranischer Sicht dreierlei: Erstens die Inversion, also die bewusste diametrale Umkehrung des ursprünglichen Wortsinns; zweitens die täuschende Interpretation von Ambivalenzen in heiligen Texten; drittens die intentionale Intransparenz bezüglich des vorhandenen Wissens. Zur Illustration dieser Problematik problematisierte Ghaffar mehrere Koranstellen, darunter Sure 2, wo scheinbar den Juden vorgeworfen wird, dass sie das Wort Gottes gehört und nachdem sie es verstanden hatten, wissentlich entstellt hätten. Aus dieser Analyse leitete Ghaffar drei positive hermeneutische Prinzipien für den interreligiösen Dialog ab: Erstens die Unverletzlichkeit der Heiligen Schrift – der explizite Wortsinn darf nicht diametral umgekehrt werden; zweitens die epistemische Transparenz, also die Offenlegung der hermeneutischen Voraussetzungen und Intentionen; und drittens die interpretatorische Redlichkeit – also keine bewusst polemische oder täuschende Interpretation.
Bechmann widmete sich in ihrem Vortrag der Rezeption der Abraham-Figur im Neuen Testament. Sie betonte eingangs, dass Paulus als jüdischer Theologe innerhalb des frühjüdischen Pluralismus zu verstehen sei. An zwei Beispielen – dem Galaterbrief (Kapitel 3-4) und den Genealogien bei Matthäus und Lukas – zeigte sie, wie die neutestamentlichen Autoren mit Bezug auf Abraham eine neue Identität konstruierten.
Für Paulus musste sich jede Neuerung vor der Vergangenheit rechtfertigen. In Galater 3-4 argumentiert er, dass der Glaube vor dem Gesetz kommt, indem er auf Genesis 15 verweist, wo Abraham glaubte und Gott ihm dies zur Gerechtigkeit anrechnete. Diese zeitliche Abfolge ist für Paulus entscheidend: „Zuerst kommt der Glaube, und das ist das Würdige.“ Dadurch kann er Abraham als „Vater der Völker“ mit sich selbst als „Apostel der Völker“ verbinden. Die eigentliche rhetorische Leistung liegt darin, dass Paulus den verheißenen Nachkommen nicht namentlich als Isaak identifiziert, sondern als Christus deutet: „Der verheißene Nachkomme wird nicht beim Namen genannt, denn der Verheißene ist Christus.“ In Galater 4 entwickelt Paulus diese Argumentation weiter, indem er die Figuren Sara und Hagar heranzieht. Durch allegorische Deutung und Typologie verbindet er Sara mit der Freiheit und dem „oberen Jerusalem“, während Hagar für das Gesetz und das gegenwärtige Jerusalem steht. Dabei sei in der Sara-Geschichte das Motiv der Unfruchtbarkeit mit der Verheißung verbunden, was Paulus mit dem Zitat aus Jesaja 54,1 erinnert: „Die Unfruchtbare gebiert.“
Bei den Evangelien von Matthäus und Lukas zeigte Bechmann, wie die unterschiedlichen Genealogien jeweils andere theologische Akzente setzen. Matthäus beginnt mit dem „Buch der Ursprünge“ von Abraham über David zu Jesus und signalisiert damit eine „neue Schöpfung“. Auffällig ist die Nennung von vier nichtisraelitischen Frauen, darunter Ruth, die Moabiterin, was die Öffnung für die Völker signalisiert. Lukas hingegen beginnt mit Jesus und führt die Linie zurück über Abraham bis zu „Adam, von Gott“ und betont damit die Sohnschaft Jesu.
Bechmann schloss mit der Beobachtung, dass in allen drei Rezeptionsvarianten Abraham vom Zentrum an den Rand rückt, während Christus ins Zentrum gestellt wird. Dennoch bleibt Abraham als legitimierender Bezugspunkt wichtig für die neue Gemeinschaft, die sich für Nichtjuden öffnet.
Klein stellte in ihrem Vortrag die rabbinische Tradition als „Revolution in der Antike“ vor. Seit dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert etablierten sich die Rabbinen als Gruppe von Schriftgelehrten, die das Prinzip der mündlichen Tora entwickelten. Diese wurde nach rabbinischem Verständnis zusammen mit der schriftlichen Tora am Berg Sinai gegeben, jedoch mündlich tradiert.
Klein betonte die Pluralität des Judentums, die sich auch in der rabbinischen Tradition widerspiegelt. Die mündliche Tora zeichnet sich insofern durch Innovation aus, als sie die schriftliche Tora nicht nur interpretiert, sondern weiterentwickelt. Ein zentrales Merkmal der rabbinischen Hermeneutik ist die Vielfalt der Auslegungen: „Es geht nicht darum, einen ursprünglichen Wortsinn zu rekonstruieren, sondern den vorhandenen Text in möglichst vielfältiger Weise zu interpretieren.“ Diese programmatische „Antidogmatik“ stehe im Kontrast zu einem doktrinären Absolutismus. Zur Illustration dieser Auslegungspraxis präsentierte Klein die bekannte talmudische Erzählung über Rabbi Eliezer und seinen Streit mit den anderen Rabbinen. Als alle seine Argumente – sogar ein Wunder und eine göttliche Stimme – ignoriert werden, erklärt Rabbi Jeremia: Die Torah ist bereits am Sinai gegeben und deshalb sei auch eine göttliche Stimme gar nicht mehr zu berücksichtigen. Stattdessen sei nach der Mehrheit zu entscheiden – und diese stünde nun einmal gegen Eliezer. Die Pointe besteht darin, dass Gott selbst lächelt und sagt: „Meine Kinder haben mich besiegt.“
Klein stellte diese Erzählung in Kontrast zur christlichen Rezeption, beispielhaft an Johann Anton Eisenmenger, der 1700 in seinem antijüdischen Werk „Entdecktes Judentum“ diese Geschichte als Beleg für die angebliche jüdische Blasphemie verwendete und sogar den Text manipulierte, um Gottes Lächeln zu eliminieren.
Als Beispiel für die Fortsetzung dieser rabbinischen Tradition in der Gegenwart schilderte Klein ihre eigene Erfahrung beim Rabbinical College, wo sie als Teil ihres Studiums aufgefordert wurde, einen eigenen Midrasch zu verfassen. Sie entwickelte „Mirjams Tagebuch“ für die sieben Tage, während derer Mirjam aus dem Lager ausgeschlossen war – eine kreative Füllung einer biblischen Leerstelle. Abschließend berichtete Klein von einem interreligiösen Workshop, den sie gemeinsam mit einer muslimischen Kollegin durchführte, bei dem beide „schwierige Texte“ aus ihren Traditionen behandelten: „Das war ein unglaublich fruchtbares Gespräch und sehr erhellend“: „Einfach wirklich in einem geschützten Raum anzuerkennen: Es gibt Texte, die wirklich sehr schwierig sind, und wir haben alle damit zu kämpfen.“
In der anschließenden Diskussion wurde unter anderem der Umgang mit schwierigen, polemischen Texten in den Religionen vertieft. Professor Ghaffar betonte, dass koranische Kritik an jüdischen Praktiken oft selbst in jüdischen Traditionen Anknüpfungspunkte finde, was aber nicht ihre polemische Natur zu verneinen erlaube. Vielmehr erfordere der Umgang mit solchen Texten eine sorgfältige Kontextualisierung.
Ein weiteres wichtiges Thema war die Frage nach der Aktualität religiöser Texte im Kontext politischer Machtverhältnisse. Professorin Klein betonte, dass religiöse Texte nicht für politische Zwecke missbraucht werden dürfen und umso weniger eine Verletzung elementarer Rechte rechtfertigen können.
Thematische Foren: Raum für Diskussion und Vertiefung
In vier parallelen thematischen Foren wurden unterschiedliche Aspekte des interreligiösen Dialogs und der Beziehungen zwischen Judentum, Christentum und Islam beleuchtet.
Forum 1: Rezeptionen jüdischen Denkens in Christentum und Islam
Das erste Forum widmete sich der Rezeption jüdischen Denkens in christlichen und islamischen Traditionen. Prof. Michael Bongardt (Universität Siegen) stellte in seinem Vortrag drei bedeutende jüdische Denker des 19. und 20. Jahrhunderts vor: Hermann Cohen (1842-1918), Hans Jonas (1903-1993) und Emmanuel Levinas (1905-1995). Diese Philosophen haben in einer Zeit tiefgreifender Umbrüche – geprägt von aufkommender atheistischer Religionskritik, Säkularisierung und schließlich der Shoah – die Frage nach Gott wachgehalten und dabei auch die christliche Theologie maßgeblich beeinflusst.
Bongardt zeigte auf, wie Cohen zunächst Kants Ethik als „Vollendung des Judentums“ verstand, später jedoch in seinem posthum veröffentlichten Werk „Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums“ die Bedeutung der persönlichen Gottesbeziehung betonte. Jonas wiederum entwickelte nach Auschwitz eine radikale Neudeutung des Gottesbegriffs, indem er die Allmacht Gottes infrage stellte. In seinem vielbeachteten Essay „Der Gottesbegriff nach Auschwitz“ argumentierte er, dass angesichts der Shoah entweder die Liebe Gottes, seine Verstehbarkeit oder seine Allmacht aufgegeben werden müsse – und entschied sich für letzteres. Levinas setzte sich für eine Philosophie ein, in der die Ethik der Ontologie vorgeordnet ist: Der Beginn des Denkens liegt für ihn im Moment, in dem ein Mensch einen Anderen ansieht und dieses Angesehen-Werden ernst genommen wird.
Prof. Ufuk Topkara (HU Berlin) ergänzte die Diskussion, indem er die Bedeutung jüdischer Denker für die Entwicklung einer zeitgenössischen islamischen Theologie im europäischen Kontext erläuterte. Er argumentierte, dass für Muslime in westlichen Gesellschaften die Auseinandersetzung mit modernen jüdischen Denkern besonders fruchtbar sein kann, da diese ähnliche Herausforderungen bewältigen mussten: die Navigation zwischen religiöser Tradition und moderner Philosophie sowie die Erfahrung des Andersseins in der Mehrheitsgesellschaft.
Anhand von Hannah Arendts Essay „On Violence“ zeigte Topkara exemplarisch, wie ihre Gedanken zu Gewalt und Macht aus islamischer Perspektive rezipiert werden können. Arendts Unterscheidung zwischen Gewalt als Werkzeug und Macht als Ergebnis gemeinsamer Zustimmung korrespondiert mit islamischen Werten, die Geduld, Mitgefühl und friedliche Konfliktlösung betonen. Ihre Kritik an der Idealisierung von Gewalt und ihre Betonung individueller Verantwortung bieten Anknüpfungspunkte für eine islamische Ethik, die Gerechtigkeit und das Wohlergehen der Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt.
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen der Situation deutscher Juden in der Vergangenheit und der muslimischen Minderheit heute einen fruchtbaren Ausgangspunkt für theologische Reflexionen bieten können, ohne dabei die historischen Unterschiede zu verwischen. Auch wurde die lange Geschichte des intellektuellen Austauschs zwischen jüdischen und muslimischen Gelehrten im Mittelalter thematisiert, die als Inspiration für heutige Dialogbemühungen dienen kann.
Forum 2: Normativität der Religion und Folgen für das Zusammenleben
Das zweite Forum beleuchtete, wie religiöse Normen das Zusammenleben in pluralen Gesellschaften prägen und herausfordern können. Dr. Hakki Arslan vom Leibniz-Institut für Jüdische Geschichte und Kultur in Leipzig diskutierte die islamische Normenlehre in ihren Auswirkungen auf interreligiöse Beziehungen. Er erläuterte, wie die islamische Rechtstradition sowohl integrativ als auch exkludierend interpretiert werden kann, abhängig davon, ob das soziale Umfeld als bedrohlich oder kooperativ wahrgenommen wird.
Anhand historischer Beispiele wie den ḏimma-Regelungen, die trotz ihres diskriminierenden Charakters Christen und Juden gewisse religiöse Freiheiten gewährten, zeigte Arslan, wie rechtliche Normen das Verhältnis zwischen Religionsgemeinschaften strukturierten. Auch gegenwärtige Fragen, etwa ob Muslime ihren christlichen und jüdischen Nachbarn zu religiösen Feiertagen gratulieren dürfen oder die Diskussion um interreligiöse Eheschließungen, verdeutlichen, dass es dabei oft weniger um Feindseligkeit als um die Bewahrung religiöser Identität geht.
Prof. Burkhard Berkmann von der LMU München brachte eine katholisch-kirchenrechtliche Perspektive ein. Er betonte, dass religiöses Recht einerseits der Abgrenzung dienen kann, wie etwa in der Gesetzeskritik des Paulus, andererseits aber auch Beziehungen zwischen Menschen verschiedener Religionen schaffen kann. Das heutige katholische Kirchenrecht bemühe sich, bei interreligiösen Ehen die Gewissensfreiheit des nichtkatholischen Partners zu achten und dessen Tradition zu berücksichtigen.
Prof. Ronen Reichman von der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg gab Einblicke in die Besonderheiten des rabbinischen Rechtsdiskurses. Er erläuterte, dass im Judentum zwar einerseits eine scharfe Trennung zwischen Politik und Religion ausgeschlossen ist, insofern die jüdische Religion aus einem System religiöser Gesetze besteht, die auch die Grundlage eines Staates bilden können. Gleichwohl sei das Konzept eines theokratischen Staates bereits im rabbinischen Rechtsdiskurs stark relativiert worden. Vielmehr biete die rabbinische Rechtskultur selbst, wie sie aus den klassisch-rabbinischen Schriften zu erschließen ist, auf der Ebene ihrer rechtshermeneutischen Formierung die Grundlage für eine Begrenzung.
Forum 3: Erinnerungskultur und Gedächtnis der Konflikt- und Begegnungsgeschichte
Das dritte Forum beleuchtete die Bedeutung von Erinnerungskultur und historischem Gedächtnis für den interreligiösen Dialog. Leyla Jagiella, bis 2024 Projektleiterin der Jüdisch-Muslimischen Kulturtage Heidelberg, teilte ihre praktischen Erfahrungen aus der jüdisch-muslimischen Dialogarbeit, insbesondere nach den Ereignissen vom 7. Oktober 2023. Ihr Vortrag kreiste um die zentralen Fragen: Was können wir aushalten? Was müssen wir aushalten? Und wieviel Aushalten verträgt und zugleich braucht eine freiheitliche demokratische Kultur?
Jagiella plädierte für eine Kultur des „Aushaltens“ von Differenzen und schwierigen Gesprächen, betonte aber gleichzeitig die Notwendigkeit, Bedingungen und Regeln für dieses Aushalten zu diskutieren. Gerade in Krisenzeiten könne eine jüdisch-muslimische Gesprächskultur besonders wertvoll sein, wenn sie auf gegenseitigem Respekt und der Bereitschaft basiert, auch unbequeme Positionen anzuhören.
Meyrav Levy von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern stellte die Arbeitsweise im Programm „Jüdisches Leben und kulturelles Erbe in bayerischen Museen“ vor. Sie problematisierte, dass jüdische Geschichte in vielen Museen oft isoliert oder eindimensional dargestellt wird – entweder ausschließlich im religiösen Kontext oder im Zusammenhang mit der NS-Geschichte. Stattdessen sollte jüdische Geschichte in ihrer Vielfalt besser sichtbar gemacht werden und als integraler Bestandteil auch der lokalen Geschichte verankert werden, wobei auch oft vernachlässigte Aspekte wie die jüdische Geschichte des Mittelalters, der Frühen Neuzeit und der Nachkriegszeit berücksichtigt werden sollten.
Forum 4: Judentum und jüdisches Leben in Bildungskontexten
Das vierte Forum widmete sich der Darstellung von Judentum und jüdischem Leben in verschiedenen Bildungszusammenhängen. Dr. Elisabeth Migge von der Universität Tübingen eröffnete mit grundlegenden Fragen aus christlich-theologischer Perspektive: Wie lässt sich über die Vielfalt im Judentum sprechen, ohne in einen Prozess des „Othering“ zu verfallen? Wie kann jüdisches Leben in Bildungsprozessen wahrnehmbar gemacht werden, ohne Stereotype zu reproduzieren?
Migge thematisierte die jahrhundertelange Geschichte der christlichen Judenfeindschaft, die sich in zahlreichen theologischen Konzepten manifestiert hat und bis heute nachwirkt. Sie stellte Konzepte wie die „dialogsensible Traditionshermeneutik“ vor, die für die christliche Theologie und Religionspädagogik Orientierung geben können. Zentrales Anliegen ist dabei eine antisemitismuskritische Bildung, die sowohl in der Hochschulbildung von Theologinnen und Theologen als auch im schulischen Religionsunterricht verankert sein sollte.
Juniorprofessorin Dr. Naciye Kamçili-Yildiz von der Universität Paderborn diskutierte die Thematisierung des Judentums im islamischen Religionsunterricht. Sie erläuterte, dass das Judentum als abrahamitische Religion zwar ein zentraler Bestandteil der Curricula des islamischen Religionsunterrichts in allen Bundesländern ist, es aber bislang an einer differenzierten, fachwissenschaftlich fundierten Perspektive auf das interreligiöse Lernen mit Fokus auf das Judentum mangelt. Sie analysierte, wie das Judentum in den aktuellen Lehrplänen der Grundschule sowie der Sekundarstufen I und II verschiedener Bundesländer repräsentiert wird, und analysierte exemplarisch Schulbücher und Unterrichtsmaterialien des islamischen Religionsunterrichts. Dabei bestehe noch erheblicher Entwicklungsbedarf, um eine ausgewogene und differenzierte Darstellung zu gewährleisten.
Die Foren machten deutlich, dass der interreligiöse Dialog in unterschiedlichen Bereichen – von der akademischen Theologie über Rechtsdiskurse und Erinnerungsarbeit bis zur Bildung – einen wichtigen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis und zu einem respektvollen Zusammenleben leisten kann.
Viel Dynamik in der interreligiösen Projektarbeit




Den Abschluss des zweiten Konferenztages bildete ein offenes Forum im Foyer des Tagungshauses, bei dem zahlreiche Projekte und Forschungsvorhaben präsentiert wurden. Die unterschiedlichen Initiativen boten den Tagungsteilnehmenden die Möglichkeit, sich im direkten Gespräch über konkrete Projekte zu informieren und Kontakte zu knüpfen.
Vertreten waren Initiativen, die auf direkte Begegnung und Austausch zwischen den religiösen Traditionen setzen. So stellte Kiril Denisov das Projekt „Schalom und Salam“ vor, das durch Workshops und Bildungsangebote Brücken zwischen jüdischen, muslimischen und anderen Gemeinschaften baut. Dabei werden bewusst auch sensible Themen wie der Nahostkonflikt, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus thematisiert.
In ähnlicher Weise präsentierten ehrenamtlich Mitwirkende das am Zentralrat der Juden koordinierte Begegnungsprojekt „Meet a Jew“, bei dem bundesweit über 500 jüdische Ehrenamtliche für persönliche Begegnungen in Schulen, Universitäten und anderen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Der Fokus liegt dabei nicht auf der Geschichte, sondern auf dem lebendigen Alltag von Jüdinnen und Juden heute, um das oft abstrakte Bild „der Juden“ in unserer Gesellschaft aufzubrechen.
Mehrere Projekte widmen sich speziell dem Dialog in Bildungskontexten. So stellte Büşra Çebi von der Stiftung Weltethos das Talkformat „Religion? All you can ask!“ vor, bei dem jüdisch-muslimische Tandems in Schulen und Bildungseinrichtungen einen offenen Austausch ermöglichen. Pia Preu und Mert Kizildemir präsentierten mit „Stadtdetektive“ ein Angebot für Grundschulkinder, das durch Besuche von Synagogen, Moscheen und Kirchen religiöse Vielfalt in Stuttgart erfahrbar macht.
Die aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt spiegelten sich in mehreren Projekten wider. Das Team des Hauses der Religionen Hannover stellte das Projekt „Der globale Konflikt im Klassenzimmer“ vor, das Lehrkräfte im Umgang mit den Auswirkungen des 7. Oktober 2023 unterstützt und didaktische Konzepte für den Unterricht entwickelt. Auch Michèl Ali Schnabel von der Muslimischen Akademie Heidelberg präsentierte Initiativen zur Antisemitismusprävention und zur Stärkung des gegenseitigen Verständnisses zwischen jüdischen und muslimischen Communities.
Eine Film-Dokumentation einer interreligiösen Studienreise nach Tunesien wurde von Leila Ben-Abid, Kathrin Wache und Pascal Schprintz von der Universität Tübingen vorgestellt. Unter dem Titel „North Africa in Late Antiquity and Early Islamic Time: Augustin, Oqba und die Anderen“ gewährt die Dokumentation Einblicke in das spätantike und frühislamische Tunesien und zeigt Begegnungen zwischen Studierenden aus Deutschland, Tunesien und Algerien.
Aus ihrem Bereich der Bildungsarbeit präsentierte die Eugen-Biser-Stiftung zwei Projekte: Die „Grundqualifizierung für Dialoggestalter*innen für religiöse Vielfalt“ bildet Personen aus, die Workshops im Rahmen von Projekttagen an Schulen durchführen können. Das Projekt „Religiöse Vielfalt gemeinsam Lernen und Leben in Bayern und Baden-Württemberg“ (ReViLBa²) zielt darauf ab, nachhaltige Strukturen für eine dialogfähige und religionssensible Schulkultur zu schaffen.
Auch die universitäre Bildung war vertreten: Patrick Lindermüller stellte den Erweiterungsstudiengang „Interreligiöse Mediation“ der Universität Augsburg vor, der sich insbesondere an Lehrkräfte richtet, die Kompetenzen im Umgang mit Konflikten mit religiösen Hintergründen erwerben möchten.
Ebenso wurden Forschungsprojekte präsentiert, die sich mit theologischen und historischen Aspekten des interreligiösen Dialogs befassen. Sarah Lebock stellte das „Forum für Komparative Theologie“ der Universitäten Paderborn und Bonn vor, das den Transfer Komparativer Theologie von den Universitäten in die Gesellschaft fördern will. Dr. Thomas Würtz vom Orient-Institut Beirut präsentierte seine Forschung zu Zitaten aus dem Neuen Testament im Korankommentar Ibrāhīm al-Biqā’īs, die bemerkenswert weit davon entfernt sind, als lediglich verfälschend und unbrauchbar zur Erklärung des Korans verstanden zu werden.
Benedikt Körner vom Erzbistum Paderborn stellte die Handreichung „…und jetzt? Leitlinien zum Umgang mit antijüdischen Bildwerken in und an Kirchenräumen“ vor. Diese von katholischen (Erz-)Bistümern und evangelischen Landeskirchen in NRW gemeinsam entwickelte Publikation bietet Gemeinden Orientierung im Umgang mit antijüdischen Darstellungen in Kirchengebäuden.
Das offene Forum bot insgesamt einen Einblick in die Vielfalt aktueller Initiativen im Bereich des interreligiösen Dialogs und der Bildungs- und Projektarbeit unter vielfachem Einbezug jüdischer Partner. Besonders deutlich wurde dabei, dass der Dialog nicht nur theoretisch, sondern vor allem praktisch und vor Ort geführt werden muss, um Brücken zu bauen und gegenseitiges Verständnis zu fördern.
Erzählungen über die Anderen im Spannungsfeld von Differenz- und Identitätskonstruktionen
Der letzte Tagungstag begann mit einem Podium zum Thema „Identität durch Differenz? Narrative und Gegen-Narrative über Beziehungen zum Judentum“, das beleuchtete, wie Differenzkonstruktionen und stereotype Wahrnehmungen in den interreligiösen Beziehungen zwischen Judentum, Christentum und Islam wirken und welche Gegennarrative entwickelt werden können.
Prof. Katharina von Kellenbach zeigte exemplarisch, wie notwendig eine kritische Analyse von religiösen Bildtraditionen und ihren problematischen Auswirkungen ist. Im Projekt „Bildstörungen“ an der Evangelischen Akademie zu Berlin hat sie untersucht, wie in der christlichen Tradition antijüdische Zerrbilder entstehen, die bis heute nachwirken und oft unbewusst reproduziert werden. Denn, wie Sie betonte: Vorurteile werden erlernt und fallen nicht vom Himmel. Und besonders in Kinderbüchern und religiösen Bildungsmedien würden problematische Stereotype vermittelt und in „Kinderköpfe eingepflanzt“.
Anhand der Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin (Joh 8,1-11) zeigte sie, wie in der christlichen Bibelauslegung und Religionspädagogik oftmals problematische Bilder von Jüdinnen und Juden vermittelt werden. Diese Geschichte erfreue sich „großer Beliebtheit“ und vermittele dann oftmals „wie beiläufig, dass Gewalt gegen Frauen ein ‚jüdisches‘ Problem sei“. Die Geschichte werde nämlich nicht selten fälschlich so präsentiert, als schütze Jesus eine Ehebrecherin vor der Steinigung durch gesetzestreue Pharisäer, wodurch bereits Kinder lernten, „jüdische Schriftgelehrte als Fanatiker und Frauenfeinde zu fürchten“. Überhaupt werde statt einer auch auf die eigenen Ungleichheitsstrukturen gewandten Behandlung der Frauenthematik häufig versucht, die eigene Überlegenheit herauszustellen, indem man den anderen Religionen Frauenfeindlichkeit vorwirft.
Am Beispiel eines Kurzfilms von katholisch.de zur Geschichte der Ehebrecherin demonstrierte von Kellenbach, wie antijüdische Stereotype reproduziert werden: Die jüdischen Gesetzeslehrer werden als mordlustig und rachsüchtig dargestellt und sagen enttäuscht „Schade!“, als sie die Frau nicht steinigen dürfen. Das sei eine falsche Interpretation des biblischen Textes – wie sie nicht selten sei. Dabei wird gleich Mehreres verkannt: Erstens finde die Szene im Tempel statt, was eine Steinigung historisch ausschließe, da der Tempel ein Ort der Gesetzesdiskussion und nicht der Lynchjustiz war. Zweitens wären dem Gesetz zufolge beide Ehebrecher – Mann und Frau – zu bestrafen. Drittens würde eine Verurteilung wegen Ehebruchs zwei bis drei Zeugen erfordern, was in der Praxis eine Todesstrafe nahezu unmöglich mache. Nicht selten und gerade auch in Darstellungen in Religionsbüchern würden zudem die Pharisäer mit Steinen in der Hand abgebildet, obwohl dies im Text nicht erwähnt wird. Selbst die feministische Theologin Luise Schottroff interpretiere die Szene fälschlicherweise als Lynchjustiz.
Besonders problematisch sei die Übertragung solcher Bilder auf heutige Kontexte: „Damit haben wir den Schritt vom Antijudaismus zur Islamfeindlichkeit“, erklärte von Kellenbach. Im Nationalsozialismus sei zudem das Bild des „jüdischen Vergewaltigers“ immer wieder für judenfeindliche Hetze instrumentalisiert worden. Hinzu komme eine weitere Übertragung: Gewalt gegen Frauen werde häufig als spezifisch muslimisches Problem dargestellt, während sie tatsächlich in allen Religionen und Gesellschaftsschichten vorkomme. Überhaupt werde statt einer auch auf die eigenen Ungleichheitsstrukturen gewandten Behandlung der Frauenthematik häufig versucht, die eigene Überlegenheit herauszustellen, indem man den anderen Religionen Frauenfeindlichkeit vorwirft. Dagegen sei die Maxime „Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“ nicht nur ein wichtiger Anstoß zur Selbstkritik, sondern auch ein wertvolles Motto für den interreligiösen Dialog.
Prof. Amir Dziri untersuchte unterschiedliche Narrative, die zur Beschreibung der jüdisch-muslimischen Begegnung genutzt werden. Er präsentierte vier dominante Narrative und analysierte deren Implikationen:
Erstens das Narrativ einer Symbiose: Es geht von einer Strukturähnlichkeit zwischen Judentum und Islam aus und betont die Durchlässigkeit muslimischer Gesellschaften für Nichtmuslime trotz formaler Diskriminierung. Die Kritik daran ist, dass es eine pauschale Einvernehmlichkeit suggeriert und ein gefährliches Umkehrpotential birgt.
Zweitens ein mytisches Narrativ, das behauptet, ein interreligiöses Zusammenleben in wechselseitiger Anerkennung habe nie existiert. Vielmehr habe eine stillschweigende Vereinbarung bestanden, in der jüdische Anpassungskultur und muslimische Überlegenheitskultur sich ergänzten.
Drittens ein Narrativ von Nähe und Distanz: Basierend auf sozialpsychologischen Theorien betont dieses Narrativ, dass die Nichtmöglichkeit von Abgrenzung das Bedürfnis danach verstärkt. Kritisiert wird dessen Tendenz, historische und theologische Analyseebenen auszublenden.
Viertens ein Narrativ der Koevolution: Dieses spricht von einem wechselseitig abhängigen Fortschreiten der Religionen, ohne existenzielle Abhängigkeit.
Dziri analysierte zudem die islamische Schutzgarantie (ḏimma) als Konzept zur Regelung der Beziehung zu Nichtmuslimen und die damit verbundenen normativen Probleme: „Die Schutzgarantie ist für viele Rechtsgelehrte und im muslimisch-zivilisatorischen Bewusstsein ein Aspekt der Gerechtigkeit und der göttlichen Wahrheitsordnung.“
Er schloss mit der Vorstellung zweier moderner muslimischer Ansätze, die islamische interreligiöse Ethik neu zu denken: Mahmoud Ayoubs Plädoyer für eine Rückkehr zum ursprünglichen Geist der Schutzgarantie und Ahmad al-Gubanchis „Zivilislam“.
Rabbiner van Voolen setzte ein mit Gewalt legitimierenden Verzweckungen biblischer Texte. Dazu zog er Psalm 149 heran, der von einem „zweischneidigen Schwert“ spricht, mit dem die Getreuen Gottes sich gegen ihre Feinde wehren sollen. Dies führt zur Frage: „Legitimiert der Psalm 149 einen Vernichtungskrieg?“ So werde der Psalm in der Tat etwa in ultraorthodoxen jüdischen Kreisen zur Legitimierung von Gewalt genutzt. Dagegen haben aber bereits klassische Interpretationen eine nicht-kriegerische Deutung begründet. Dabei werde auch die Erfahrung der Rabbinen nach der Zerstörung des Zweiten Tempels in Folge des gewaltsamen Aufstands erinnert: „Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch meinen Geist, spricht der Ewige der Heerscharen.“ Tatsächlich führe eine genaue Analyse des hebräischen Textes zu einer ganz anderen Lesart: „Dann sind die Lobgesänge der Chassidim, der Getreuen, das Schwert, mit dem sie das Recht Gottes durchsetzen. Und dann ruft der Psalm nicht zu einer gewaltbereiten Radikalisierung im Namen der Religion auf, sondern genau zum Gegenteil.“
Van Voolen schloss mit einem eindringlichen Appell für Gerechtigkeit, die als universell und nicht auf eine Gruppe beschränkt verstanden werden müsse: „Ohne Gerechtigkeit bleibt Frieden ein leeres Wort. Die Verwirklichung verlangt ein gegenseitiges Verstehen und Zuhören und irgendwann Versöhnung. Dies braucht Zeit, aber auch Engagement, Geduld, aber auch Liebe zu Menschen. Wir sind ja alle in Gottes Ebenbild geschaffen.“
Die anschließende Plenumsdiskussion eröffnete von Kellenbach mit der Beobachtung: „Ich fand es geradezu hoffnungsvoll, dass wir jeweils aus unseren eigenen Kontexten unsere eigenen Geschichten auch noch mal auf Exklusion hin betrachtet haben. Das Thema war ja Identität durch Differenz, und wir haben jeweils noch mal selbstkritisch auf unsere eigenen Texte geschaut.“ Das Verhältnis von Partikularismus und Universalismus sei in den religiösen Traditionen im Grunde nicht auflösbar, aber: „Es ist immer billig, die eigene Identität über die Abgrenzung von anderen zu konstruieren. Das ist ein Mechanismus, der sich in allen Gemeinschaften, in allen Identitäten anbietet, auch in den säkularen. Und es ist immer geboten, dagegen zu kämpfen.“
Amir Dziri wurde angesichts des Tableaus an Narrativen, das er zunächst deskriptiv präsentiert hatte, nach seiner eigenen Bewertung gefragt: „Persönlich sind mir am nächsten die Narrative von Nähe und Distanz und Koevolution, weil ich tatsächlich den Eindruck habe, dass so viele Familienähnlichkeiten zwischen Judentum und Islam bestehen, dass es einfach auch Bedürfnisse nach Abgrenzung gibt. Die Geschichte der jüdisch-muslimischen Beziehungen ist geprägt von dieser Komplexität der Gleichzeitigkeit von Wärme und Kälte, von Inklusion und Exklusion.“ Konkret regte er an: „Wie kann man jüdisch-muslimisches Gespräch oder Solidarität stärker in die Mitte dieser beiden Selbstverständnisse bringen? Ich habe den Eindruck, dass Muslime sehr, sehr wenig über Judentum wissen und dass Juden aber auch sehr wenig über Islam wissen. Da braucht es eine inhaltliche Annäherung.“ Zudem bestünden intellektuelle Herausforderungen, weil es zu wenig „Begründungsangebote gibt, die sich sozialpraktisch umsetzen lassen“. Die muslimische Sozialethik brauche beispielsweise neue Konzepte: „Es führt kein Weg daran vorbei, große Fragen zu stellen – von der Wahrheitstheorie über Gerechtigkeit bis hin zur interreligiösen Ethik.“
Rabbiner van Voolen zeigte sich besorgt angesichts gesellschaftlicher Ausgrenzungen und zunehmender Hassrede gegen Minderheiten: „Das ist zutiefst beunruhigend, weil ich weiß, dass wenn man eine Gruppe anfängt zu diskriminieren – die Muslime stehen jetzt groß unter Beschuss in Deutschland, in Europa, in den Niederlanden… – dann weiß ich, dass wir die zweite sind.“ Stattdessen brauche es ein zusammenwirken über Gruppengrenzen hinweg: „Wir können nur gemeinsam daran arbeiten. Wir sind alle Minoritäten. Christen sind eine Minorität in der europäischen Gesellschaft. Muslime sind eine Minorität. Und wir sind die kleinste Minorität. Wir haben viel gemeinsam. Was uns vereint, sollten wir thematisieren und gesellschaftlich religiös einbringen mit einer starken Stimme.“
Andererseits wurde darauf insistiert, dass das „Verweisen auf Gemeinsamkeiten“ noch nicht ausreiche, sondern es auch „einen anderen Umgang mit Differenz“ brauche: „Wir müssen Differenz wirklich als produktiv verstehen.“ In der Geschichte seien Differenzen dagegen allzuoft Anlass für Ausgrenzung und Gewalt gewesen: „Ich hatte eigentlich erwartet, dass der Titel ‚verwandt, verflochten, verfeindet‘ heißt. Die Feindschaft, die Toten zwischen uns, die Massengräber, die brauchen eigentlich auch einen Platz. Wir müssen das Abgründige, die Gewalt und die Trauer über die Gewalt ernst nehmen.“ Das erfuhr Zustimmung, aber auch Differenzierung: Man müsse beispielsweise zunächst fragen: „Wann wird Differenz zu Distinktion, zu Diffamierung, zu Feindseligkeit oder Feindschaft? Man sollte nicht bei Feindschaft oder Feindseligkeit anfangen, sondern erst mal schauen, wie verhindere ich, dass aus der Differenz überhaupt erst Distinktion oder Abgrenzung wird?“
In der Diskussion wurde auch darauf hingewiesen, dass es, ähnlich wie in der Korrektur von Fehlrezeptionen des Psalms 149, auch in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gegeben habe, beispielsweise in den Überarbeitungen der Oberammergauer Passionsspiele. Allerdings bestünden auch Feindbild-schürende Aufbereitungen fort, wie im Beispiel des vermeintlich kindertauglichen Bibelfilms, die dringend zu korrigieren wären: „Sonst haben wir gewissermaßen Oberammergau und diesen furchtbaren Antisemitismus abgeräumt, und unter der Hand kommt über diese lustigen Filmchen dasselbe in Grün wieder rüber.“
Einen Diskussionsschwerpunkt bildete außerdem auch die Situation jüdischer Studierender an Hochschulen, die sich oftmals „schutzlos ausgeliefert fühlen“ und denen „an ganz vielen Stellen“ Solidarität fehle. Es gebe aber durchaus bereits einige weiterführende Untersuchungen, Positivbeispiele und Handlungsempfehlungen, etwa zu strukturellen Maßnahmen gegen Antisemitismus an Hochschulen in Österreich.
Van Voolen merkte an: „Wir können lange darüber diskutieren. Aber wenn wir zu lange diskutieren, dann ist die Zeit vorbei, dass wir was machen können. Wir müssen agieren. Jetzt… Die gesellschaftlichen Entwicklungen sind nicht sehr positiv, wir müssen Gegennarrative aufbauen.“ Er schloss aber mit einem hoffnungsvollen Ausblick, an dem er auch für Israel und Palästina festhalte, etwa in der Bewegung „Standing Together“: „Wir stehen zusammen, tauschen aus und unterstützen einander, weil wir Gerechtigkeit wollen und ein Land für zwei Völker zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan mit 15 Millionen Menschen. Das braucht Geduld, Verständnis, einander zuhören, das Leid voneinander zuhören. Es bedeutet auch die menschliche Wärme, dass ich im anderen einen Mitmenschen erkenne.“
Podiumsdiskussion: Jüdisches Leben und interreligiöses Zusammenleben heute
Die Tagung mündete in eine Podiumsdiskussion zu aktuellen Herausforderungen für das jüdische Leben und das interreligiöse Zusammenleben in Deutschland. Dabei wurden unterschiedliche Facetten der gesellschaftlichen Wirkfelder erörtert von Dr. Michael Blume (Baden-Württembergischer Beauftragter gegen Antisemitismus und für Jüdisches Leben), Abdassamad El Yazidi (Zentralrat der Muslime), Rabbinerin Esther Jonas-Märtin (Leipzig) und Dr. Christian Staffa (Evangelische Akademie Berlin).
Blume beschrieb die zunehmende Polarisierung und eine Dynamik, in der verschiedene Gruppen gegeneinander ausgespielt werden und die besonders religiöse Minderheiten treffe – jüdische und muslimische Menschen, aber neuerdings zunehmend auch christliche. So müsse in der baden-württembergischen Kleinstadt Langenau inzwischen der Gottesdienst unter Polizeischutz stattfinden, nachdem der Pfarrer nach dem 7. Oktober für alle Opfer des Terrors gebetet hatte und daraufhin bedroht wurde. Dies zeige, wie der Antisemitismus als „Verschwörungsmythos ohne Juden“ funktioniere und letztlich alle gesellschaftlichen Gruppen bedrohe: „Wenn es eine Gruppe erst einmal freigegeben ist zum Abschuss, ist nachher gar keine mehr sicher“. Besorgniserregend sei auch die Zunahme antisemitischer Vorfälle an Hochschulen, die bereits vor dem 7. Oktober 2023 begonnen habe, sich jedoch seitdem deutlich verschärft habe. Kritisch bewertete eine Medienberichterstattung, die Terroristen und Gewalttäter zu stark in den Mittelpunkt stelle: „Wir wissen aus der Suizidforschung ganz klar, dass wenn man die Leute heroisiert und medial aufstachelt, dass es Nachahmungstäter gibt.“ Es fehle an Reflexion darüber, wie man über Terror berichten könne, ohne weitere Gewalt anzustacheln.
Rabbinerin Jonas-Märtin betonte die besonders prekäre Situation und Verletzlichkeit der jüdischen Minderheit in Deutschland. Die Diskussionslage sei momentan eine komplexe „Gemengelage“, in der verschiedene Probleme zusammenfielen und kaum mehr voneinander zu trennen seien. Sie kritisierte eine häufig einseitige mediale Berichterstattung, bei der „Ursache und Wirkung fehlen“ und vieles „sehr tendenziös berichtet“ werde. Zudem fehle es an Fingerspitzengefühl und einem Bewusstsein dafür, dass es auch eine Zeit brauche für Trauer und innere Konsolidierung: „Unmittelbar nach dem 7. Oktober oder nach Anschlägen passiert sofort ein Run auf Jüdinnen und Juden, und wir werden ausgefragt, wir werden vorgeführt, wir müssen uns sofort positionieren. Und ich finde das extrem problematisch.“ Andererseits sei nach dem 7. Oktober 2023 von vielen interreligiösen Gesprächspartnern vor allem Schweigen wahrzunehmen gewesen: „Es haben muslimische und christliche Freundinnen uns einfach im Stich gelassen.“ Zugleich verwies sie auf die besondere Situation in Ostdeutschland, wo interreligiöse Projekte oft zu wenig Beachtung fänden, da die Region als „areligiös“ abgestempelt werde. Besonders kritisierte sie, dass Dialog allzu oft nur als „Feigenblättchen“ diene, „um sich irgendwie gut zu fühlen, um darzustellen, dass man selber tolerant ist, dass man selber ja gar nicht rassistisch oder antisemitisch sein kann.“
Abdassamad El Yazidi plädierte für einen stärkeren Bürgerschaftsgedanken: „Wir haben hier alle gleiche Interessen. Wir müssen gemeinsam eigentlich gegen Ewiggestrige kämpfen, die unser Land zurückbringen wollen zu einer Zeit, die wir hinter uns geglaubt haben.“ Er forderte, dass der Dialog in Deutschland noch viel stärker eine breitere Basis erreichen müsse. Begegnungen könnten zu einem tieferen Verständnis führen, auch für die bedrohte Lage jüdischen Lebens in Deutschland, die in muslimischen Gemeinden oft noch nicht ausreichend erkannt werde. El Yazidi betonte: „Es ist nicht die Aufgabe von Juden, gegen Antisemitismus zu kämpfen. Es ist unsere Aufgabe. Und es ist nicht die Aufgabe von Muslimen, gegen antimuslimischen Rassismus aufzustehen. Es ist unsere gemeinschaftliche Aufgabe.“ Muslimischerseits könnte dazu der Bürgerschaftsgedanken erinnert werden, wie er sich auch im historischen Dokument von Medina ausdrücke, das der Prophet Muhammad einst erlassen hatte: „Wenn man sich das durchliest, dann stellt man fest, dass es da wenig um Religion geht, sondern dass es da um eine inkludierende Bürgerschaft geht.“ Dieser Gedanke umfasse sowohl „Verantwortung und Zugehörigkeit“ – dass man sich verantwortlich fühle für das, was im eigenen Land passiere und wehrhaft sei für die Demokratie. Zugehörigkeit bedeute, Teil zu sein „eben mit allen Andersdenkenden, anders glaubenden, anders aussehenden Menschen, gemeinsam diese Bürgerschaft darzustellen.“ Dazu bedürfe es auch ehrlicher Auseinandersetzung: „Kein Kämpfer gegen Antisemitismus darf im Nebensatz antimuslimischen Rassismus irgendwie befürworten“ und umgekehrt. Er sprach auch über die innermuslimische Debatte zur Holocaustverantwortung: Es habe einige Irritationen gegeben, nachdem Aiman Mazyek von der „historischen Verantwortung der deutschen Muslime dem Holocaust gegenüber“ gesprochen hatte: „Die Menschen haben nicht verstanden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Verantwortung und Schuld. Wir tragen vielleicht keine Schuld für den Holocaust, aber wenn wir sagen, wir sind Teil dieses Landes und das ist unser Land, dann kann die Geschichte, unsere Geschichte, uns nicht egal sein.“
Dr. Christian Staffa diagnostizierte eine fortdauernde Problematik innerhalb der ökumenischen Bewegung: „Weltkirchlich ist im protestantischen Milieu ein christlicher Antisemitismus sehr, sehr weitverbreitet, und der hängt sich an Israel auf.“ Kritisch merkte er an, dass es an selbstkritischer Reflexion fehle, nicht nur in der evangelischen Kirche, sondern auch im Vatikan. Das fange schon an mit theologischen „Problemen, den Staat Israel überhaupt zu denken“. Es gebe eine „Verantwortung des Welt-Christentums für Antisemitismus in der Welt“. Staffa betonte die besondere Qualität des Antisemitismus als Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit: „Der Antisemitismus hat eine extrem prominente Rolle, weil er erstens schon so lange existiert, und wir als Christinnen und Christen, als Kirchen haben dieses Paradigma gebaut.“ Das „Fundamentale des Antisemitismus“ zeige sich gerade darin, dass er gruppenübergreifend wirke. Er unterstrich die Notwendigkeit, die Beziehungsebene vor die Wahrheitsfrage zu stellen – ein Konzept, das er von Hannah Arendts Begriff der „politischen Freundschaft“ ableitete. Diese Beziehungsebene hätte vom 7. Oktober an stärker präsent sein müssen, unabhängig von konkreten politischen Positionierungen.
Aus dem Plenum heraus entwickelte sich unter anderem eine kontroverse Debatte um Verhältnisbestimmungen zwischen Antisemitismus, Antizionismus und Kritik an der israelischen Politik sowie deren Stellenwert in den Studierendenprotesten an Universitäten: Gebe es nicht auch, so wurde gefragt, Antizionisten, die keine Antisemiten seien, oder umgekehrt Zionisten mit antisemitischen Haltungen, wie etwa in Teilen der evangelikalen Rechten in den USA? Und zu welchen Anteilen waren die Studienproteste „Affekthandlungen“, die der Selbstidealisierung dienten, zu welchen dagegen legitimer Ausdruck demokratischer Meinungsfreiheit in einer Situation nicht ausreichender Räume für einen offenen und kritischen Austausch? In der Tat, so Staffa, gebe es nicht nur eine „wahnhafte Variante“ an Protesten, das wäre zu pauschal, aber durchaus eben auch Fälle, die aus seiner Sicht nicht zu rechtfertigen seien, etwa wenn Gewalt schlichtweg geleugnet werde. Und in der Tat zeige das Beispiel der antizionistischen Jüdin Judith Butlers, die zum Beispiel auch in Abrede stelle, dass es Vergewaltigungen gegeben habe, dass es ein „Riesenproblem“ sei, wenn sich auch die jüdische Community „an dieser Stelle spaltet“. Dr. Blume betonte, dass für ihn eine klare Grenze überschritten sei, wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird: „Wer einem Staat und einem Volk und einer Gruppe das Recht der Existenz abspricht, der spricht allen Staaten, allen Gruppen, allen das Recht zur Existenz ab.“
Die Diskussion zeigte exemplarisch, wie schwierig eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Israel-Palästina in der aufgeheizten Situation nach dem 7. Oktober geworden ist. Dr. Blume verwies in diesem Zusammenhang auf ein grundlegendes Problem: Die „Enge der Zeit“ – von der Hans Blumenberg als „Wurzel des Bösen“ gesprochen hatte – führe zu Polarisierung und Feind-Freund-Denken, während echter Dialog Entschleunigung und Zeit benötige.
In der Diskussion wurden zudem verschiedene Wege zur Stärkung des interreligiösen Dialogs vorgeschlagen, darunter die Schaffung von Begegnungsräumen auf Basisebene, nicht nur für Eliten; die Priorisierung von zwischenmenschlichen Beziehungen vor ideologischen Wahrheitsfragen; ein wechselseitiges Eintreten gegen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus; und eine Förderung des Bürgerschaftsgedankens und gemeinsamer Verantwortung.
Rabbinerin Jonas-Märtin schloss das Podium mit einer rabbinischen Erzählung: „Ein Rabbi sitzt mit seinen Schülern in der Yeshiva und studiert. Einer der Studenten fragt den Rabbi: ‚Rabbi, wann wird die Nacht enden?‘ Der Rabbi überlegt und sagt dann: ‚Die Nacht wird enden, wenn wir Menschen in dem Gesicht des Gegenübers den Bruder und die Schwester erkennen. Dann wird die Nacht enden.‘“