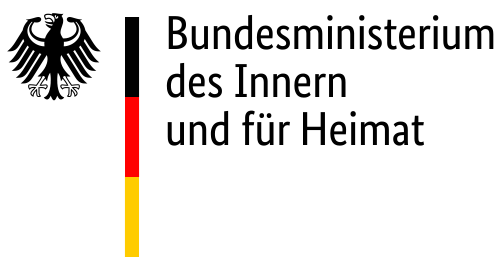Vier Studierende wurden für ihre Überlegungen zum interreligiösen Dialog beim Essaywettbewerb der Georges-Anawati-Stiftung ausgezeichnet. Der Festvortrag von Markus Vogt beleuchtete die Rolle von Religionen in gegenwärtigen Konflikten und das Verhältnis von Friedensethik und interreligiösem Dialog. Die Online-Veranstaltung fand mit ca. 80 Teilnehmenden hohen Anklang.
„Das Verhältnis von Religion und Moderne wird im Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine als eine ungelöste Spannung sichtbar. Dies ist ein Komplex, der nicht nur in der christlichen Orthodoxie, sondern in allen Religionen als virulent erscheint.“ Zur Rolle der russisch-orthodoxen Kirche betonte Prof. Markus Vogt, Inhaber des Lehrstuhls für Christliche Sozialethik an er LMU München, bei seinem Festvortrag, dass es sich keineswegs nur um eine Instrumentalisierung durch den russischen Staat handele. Die Kirche nehme vielmehr eine aktive Rolle ein, wenn beispielsweise Patriarch Kyrill I. den Westen als Antichristen bezeichne oder immer wieder auf die hohe symbolische Bedeutung von Kiew als Ursprung der orthodoxen Welt referiere.
Anerkennungs- und Identitätskonflikt
Im Grunde gehe es bei dem Angriffskrieg Putins nicht um einen Interessenkonflikt, sondern um einen Anerkennungs- und Identitätskonflikt in dem Sinne, wie Samuel Huntington von einem clash of civilisations gesprochen hat. Dementsprechend pauschal seien die für beide Seiten vorgenommenen russischen Identitätskonstruktionen. Es sei auch diesem Charakter des Konflikts geschuldet, dass wirtschaftliche Verflechtung oder die Idee von „Wandel durch Handel“ einem solchen Krieg weder Einhalt gebieten noch vorbeugend wirken könnten. Während es Vogt aufgrund der Drohung mit Atom- und Chemiewaffen für richtig hält, dass die NATO nicht direkt in den Krieg eingreift, stellt er die Unterstützung der Ukraine, insbesondere auch durch Waffenlieferungen, als ein Gebot der Solidarität dar. Ansonsten käme dies unterlassener Hilfeleistung gleich. Der Hinweis, insbesondere der Kirchen, auch auf anderen Wegen Frieden zu suchen, stehe hierzu nicht in Konkurrenz, sondern sei eine wichtige Ergänzung.
Konsequenzen für die Friedensethik und -theologie
„Der russische Angriff auf die Ukraine, die Bombardierung von Wohnvierteln großer Städte und die systematische Zerstörung der zivilen Infrastruktur, schließlich Putins unverhohlene Drohung mit einer militärischen Eskalation bis hin zum Einsatz von Atomwaffen für den Fall, dass die Nato aufseiten der Ukraine in den Krieg eingreift, haben die europäische Friedensordnung nicht nur erschüttert, sondern sie buchstäblich zertrümmert.“[1] Ausgehend von dieser Analyse Herfried Münklers fragte Vogt nach den Konsequenzen für die friedensethische und -theologische Debatte. Nachdem diese Themen viel zu lange als ein Randthema behandelt worden seien, zeige sich ihre Dringlichkeit nicht nur durch den Krieg in der Ukraine, sondern im Allgemeinen durch die Zunahme autoritärer Regime und anderer Gefährdungen der Demokratie.
Ein bemerkenswerter Vorstoß zur Wiederbelebung der Friedenstheologie sei die Enzyklika Fratelli tutti von Papst Franziskus vom 3. Oktober 2020. Nach einer bedrängenden Gegenwartsdiagnose entfalte der Text als Schlüssel zum Frieden in überzeugender Weise den Dialog. Zu undifferenziert sei hingegen die zu pauschale Ablehnung von Gewalt, insbesondere die fehlende Unterscheidung zwischen Angriff und Verteidigung. Ähnlich kritisch fiel das Urteil über die gegenwärtige Diplomatie des Vatikans im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg aus. Notwendig sei, so Vogt, zwar eine Weiterentwicklung der Lehre vom gerechten Krieg, doch blieben die in dieser Tradition gestellten Fragen nach wie vor sehr aktuell.

Proaktive Toleranz und Weiterentwicklung der internationalen Institutionen
„Die Entwicklungen im Inneren Russlands und hierbei der russischen Zivilgesellschaft werden entscheidend für den Fortgang des Kriegs sein.“ Besonders der Mut der im Exil lebenden Russen könne hierbei einen wichtigen Unterschied machen. Keinesfalls dürfe die russische Gesellschaft als zu einheitlich verstanden werden. In gleicher Weise gelte dies für die Orthodoxie, wo es an der Basis ebenfalls kritische Stimmen gebe.
Am Ende seines Vortrags dachte Vogt über mögliche Schlussfolgerungen aus seiner Analyse nach. Die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition und Geschichte eines Landes sowie einer Religion sei dabei ebenso bedeutsam wie eine richtig verstandene Toleranz. Eine solche bedeute keinesfalls, alles einfach gelten zu lassen, sondern äußere sich in einer aktiven Verteidigung der Menschenrechte und Wahrheit, aber in der Form des Zuhörens und der interessierten Auseinandersetzung. Im Sinne einer proaktiven Toleranz gehe es darum, Räume des Vertrauens zu schaffen, bevor es zu spät ist. Vogt sprach von einer „Kultur der Erinnerung“, die zum Handwerk des Friedens gehöre.
Aber auch auf der Ebene internationaler Institutionen und Bemühungen müsse neu nachgedacht werden. So sei der Sicherheitsrat immer wieder von bestimmten Staaten für ihre partikularen Interessen missbraucht worden und habe so seine Glaubwürdigkeit verspielt. Weiterhin müsse Europa seine eigene Sicherheitsstrategie entwickeln und dürfe sich dabei nicht mehr allein auf die USA verlassen.
Prämierte Essays der Studienwoche
Der immer wieder notwendigen Weiterentwicklung und Anpassung der Dialogidee an neue Herausforderungen widmeten sich die vier im Rahmen der Abendveranstaltung prämierten Essays. Diese gingen hervor aus der Studienwoche Christlich-Islamische Beziehungen im europäischen Kontext im Jahr 2021.
„Es sind niemals Religionen, die im Dialog miteinander in Beziehung treten, sondern konkrete Menschen..“ Gemäß dieser Einsicht, so Tobias Specker zu Beginn seiner Laudatio, lasse sich in den vier prämierten Essays das Leitmotiv der individuellen Religiosität und der Frage, in welcher Weise diese eine Stimme erhält, erkennen.
Einen konkreten Zugang zu dieser Frage vermittelt Martin Skowronek in seinem Essay „Dialog – Schutz für Pflegekräfte und Erhalt der Würde muslimischer Patient*innen?! Der praktische Wert des interreligiösen Dialogs am Beispiel der Pflege“. Obwohl laut Skowronek ausreichend ethische Grundlagen für pflegerische Entscheidungen vorhanden seien, fehle es im pflegerischen Alltag an Ressourcen und Zeit, um in Einzelfällen eingeübte Routinen zu durchbrechen. So sei zu beobachten, dass viele Pflegefachkräfte mit „totaler Überforderung reagieren, wenn muslimische Patient*innen beziehungsweise die Angehörigen ihren Willen äußern, der, im vom Christentum geprägten Deutschland, nicht alltäglich ist.“ Skowronek plädiert hier für vertiefte interreligiöse Bildung von Pflegekräften sowie dialogische Angebote, um mit solchen Situationen besser umgehen zu können. Ebenfalls mit dem dritten Preis prämiert wurde der Essay von Mahmoud Tayeb: „Die ‚Goldene Regel‘ des interreligiösen Dialogs. Ist es sinnvoll die ‚Goldene Regel‘ des ‚Parlaments der Weltreligionen‘ auf einen interreligiösen Dialog anzuwenden?“ Specker hebt die abwägende und sehr differenzierte Argumentation des Essays hervor, die schließlich zu einer verneinenden Antwort auf die gestellte Frage führt. Die Skepsis Tayebs bezüglich einer Übertragung der Regel rührt daher, dass auf diese Weise die Übereinkunft im Guten einfach vorausgesetzt wird. Entsprechend fraglich sei es, ob auf diese Weise eine Einfühlung in die Andersheit möglich sei.
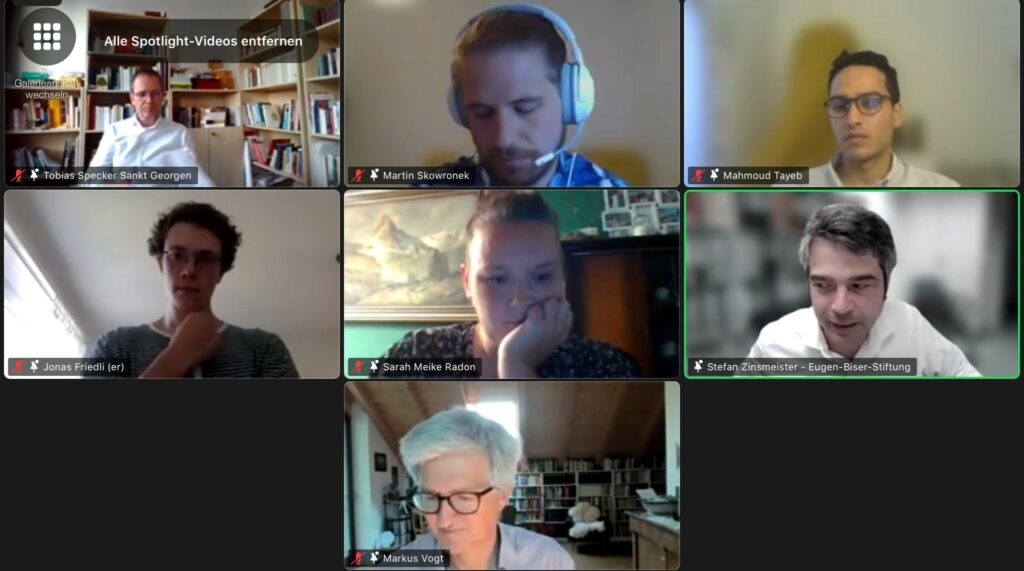
Vorurteile und Vorstrukturierungen des Dialogs
Innerhalb eines postkolonialen Referenzrahmens habe Jonas Friedli einen sprachlich pointierten Essay („Auf ‚Augenhöhe‘ mit der Moral der Geschichte?“) verfasst, der von der Jury mit dem zweiten Preis ausgezeichnet wurde. „Wenn wir uns verabschieden von der Idee, dass das Gelingen eines Dialoges und eines Zusammenlebens einzig von individuellen Tätigkeiten oder Fähigkeiten abhängt, zeichnen wir das Bild einer Gesellschaft in einem Vakuum. Denn jegliche Gesellschaft ist durchzogen von Hürden und Strukturen, von Mauern, die gewissen Menschen eine freie Sicht ermöglichen und anderen davon ausnehmen.“ Friedli plädiert von dieser Analyse ausgehend für eine Sichtbarmachung von Stimmen, die sonst nicht gehört und als das Andere abgeschnitten werden.
Auf dem ersten Platz wurde Sarah Radon mit ihrem Essay „Mit Kopftuch und Bart bekommen wir keine Wohnung. Narrative und Stereotypen im interreligiösen Dialog“ ausgezeichnet. Radon fragt, wo diese Stereotype und Narrative begegnen, wie sie ausgeprägt sind und welche Bedeutung sie im interreligiösen Dialog entfalten. Dabei entsteht laut Radon ein „Reisebericht [der] Erfahrungen, Erkenntnisse wie Eindrücke“, in den „muslimische Blickwinkel und Perspektiven gleichberechtigt“ eingeflochten sind.
Alle Essays kreisten, so Specker, mit unterschiedlichen Zugängen und in sehr produktiver Weise um den Wert individueller religiöser Erfahrung und religiöser Autonomie. Wie diese ins Zentrum gerückte religiöse Selbstbestimmung zusammengebracht werden könne mit dem Angesprochensein von außen in einer Offenbarungsreligion, wurde von Specker als ein weiterführender Gedanke skizziert.
Dialog als Friedensarbeit
An den Vortrag und die Laudatio schloss sich eine Diskussion an, die von Stefan Zinsmeister moderiert wurde. Im Zusammenhang mit den durch die Essays thematisierten Fragen nach Stereotypen wurde der Begriff des „Vorurteilsbewusstseins“ erörtert. Dieser könne zum Ausdruck bringen, dass wir uns nur schwer bis gar nicht von Vorurteilen lösen können, es aber darum gehe, sich diese bewusst zu machen und mit ihnen in Begegnung zu kommen.
Friedli vertiefte, wie es gelingen kann, die Unsichtbarkeiten sichtbarer zu machen. Entscheidend sei die Erkenntnis, dass diese Unsichtbarkeiten an Machtfragen gebunden seien und aktiv hergestellt würden.
An Prozesse der Unsichtbarmachung konnte auch Vogt anknüpfen, wenn er betonte, dass der Krieg gegen die Ukraine nicht möglich wäre, wenn die russische Zivilgesellschaft nicht zu weiten Teilen ausgeschaltet würde. Die Debatte bot Vogt auch die Möglichkeit, die Rolle des Westens noch einmal kritisch zu betrachten. So legte er dar, dass bereits seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ein Anerkennungskonflikt geführt werde und die Nichtbeachtung der Regeln des Völkerrechts nicht erst mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine begonnen habe, wie beispielsweise der Irak-Krieg zeige. Schließlich habe man es verpasst, den Zusammenbruch der Sowjetunion als Geschenk des Friedens zu nutzen und auszubauen. Stattdessen habe man dies als einen Sieg des Westens gefeiert und entsprechende Ressentiments vertieft.
Zukunftsweisend verwies Vogt auf die Notwendigkeit, eine Öffentlichkeit herzustellen und immer wieder zu erhalten, in der ein „Wir“ besteht, das sich verantwortlich fühlt und nicht nur angesichts der vielen Herausforderungen Überforderung erlebt. Dialog, nicht zuletzt interreligiöser Dialog, auch in neuen Formen, leiste somit eine entscheidende Friedensarbeit.
[1] Herfried Münkler: Die europäische Nachkriegsordnung Ein Nachruf – Essay, in: Aus Politik und Zeitgeschichte Nr. 28-29/2022 vom 08.07.2022, online unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/krieg-in-europa-2022/510251/die-europaeische-nachkriegsordnung/#footnote-target-1 [abgerufen am: 25.07.2022].