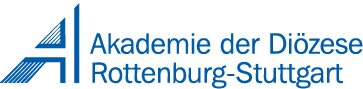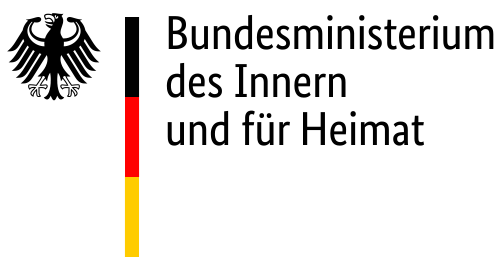Warum erfolgt in den europäischen Gesellschaften eine diskursive Zuspitzung, die extremistischen Islamdeutungen einen ungewöhnlichen Entfaltungsraum bietet? Und wieso öffnen sich zeitgleich in westlichen Öffentlichkeiten Räume für extremistische, völkische Nationalismen? Wie lässt sich diesen Entwicklungen begegnen und welche Rolle kommt dabei dem interreligiösen Dialog zu?
Mit diesen Fragen beschäftigte sich die Abendveranstaltung “Transformation der Religionen” am 27. Juni 2024 in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Den Festvortrag hielt der renommierte Islamwissenschaftler Prof. em. Dr. Reinhard Schulze. Im Anschluss wurden die Preisträger:innen des Essaywettbewerbs der Georges-Anawati-Stiftung vorgestellt.
Ihre Beiträge setzten sich auf ganz unterschiedliche Weise mit den Potentialen und Herausforderungen interreligiöser Beziehungen auseinander. Diese Essays waren hervorgegangen aus der Christlich-Islamischen Studienwoche, die die Akademie gemeinsam mit der Eugen-Biser-Stiftung ausrichtet, die auch Kooperationspartner der hybrid durchgeführten Abendveranstaltung war. Seit mehr als zwei Jahrzehnten führt die Studienwoche christliche und muslimische Nachwuchswissenschaftler:innen zusammen für einen interreligiösen und interdisziplinären Austausch.
Im Mittelpunkt des Festvortrags von Prof. Reinhard Schulze stand die These einer Erosion der modernen normativen Ordnung von Religion und Gesellschaft. Religionen drohten demnach ihre Integrationskraft und Plausibilität zu verlieren – ein Prozess, der sich am Terror vom 11. September 2001 illustrieren lasse: Dieser sei Indikator für eine neuartige Strömung im Islam, die sich außerhalb der nationalstaatlichen Ordnung positioniere. Zur Analyse dieser Entwicklung führte Prof. Schulze den Begriff der “Ultrareligiosität” ein: Ultrareligiös seien demnach Vorstellungswelten, die das Religiöse verabsolutieren, radikalisieren und jenseits (“ultra”) der modernen Ordnung von Religion und Säkularität stellen. In fundamentaler Opposition zum Staat und zur säkularen Gesellschaft schaffe sich die Ultrareligiosität eine neue, mit der islamischen Tradition kaum verbundene “Orthodoxie”.

Prof. Schulze parallelisierte dieses Phänomen mit dem “Ultranationalismus”, der den ideologischen Kern der Nation in ähnlicher Weise verabsolutiere. Auch hier konstituiere sich eine Ordnung jenseits des politischen und gesellschaftlichen Spektrums, verbunden mit einem radikalen Autoritarismus. Beide “Ultraismen” verstehe man am besten als Folge eines tiefgreifenden Wandels der Moderne, der zur Auflösung der Polarität von Religion und Gesellschaft führe.
Historisch rekonstruierte Prof. Schulze die Entstehung dieser dualen Ordnung in der Neuzeit: Religion und Welt wurden zu komplementären, wechselseitig aufeinander angewiesenen Sphären. In der Krise drohe dieses Verhältnis zu zerbrechen. Indiz dafür sei, dass Religionsgemeinschaften zunehmend die Beziehung zu ihrer “Umwelt” aufkündigten.
Um dem “Scheitern der Religion” zu begegnen, gelte es, deren Integrationskraft zu erneuern. Der Autoritätsverlust, der ultrareligiösen Strömungen Vorschub leiste, müsse durch eine Neudefinition religiöser Autorität kompensiert werden. Doch letztlich werde man eine “postreligiöse Situation” nicht verhindern können. Die Frage sei, wie eine solche Transformation verträglich gestaltet werden könne.
Im Anschluss würdigte Professor Harald Suermann vom Wissenschaftlichen Beirat der Georges-Anawati-Stiftung die prämierten Essays.



Den dritten Platz belegte Bera Elyesa Topkara mit einem Essay über die “Convivencia” im mittelalterlichen Spanien als Modell für das heutige Europa. Er analysierte das weitgehend friedliche Zusammenleben von Christen, Muslimen und Juden vor der Reconquista, das zu einem kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung führte. Im Gegensatz dazu habe das spätere Streben nach religiöser Homogenität Vertreibungen und Konflikte ausgelöst. Topkara warnte davor, heutige Narrative auf die Vergangenheit zu projizieren und stellte die Frage, inwieweit eine “rechtskulturelle Integration” des Islam in Europa möglich sei. Als Vorbild sah er die EU als multireligiöse, auf gemeinsamen Werten basierende Gemeinschaft.
Der zweite Platz ging an Hanna Morlock und Randa Abd Ulla. Morlock untersuchte “Mystik als Widerstand” und Grundlage interreligiöser Verbundenheit. Ausgangspunkt war Dorothee Sölles Konzept einer “Mystik des Widerstands”, die eine Gemeinschaft mit Gott und den Leidenden stifte. Dies sei nicht auf Christen begrenzt. Am Beispiel der ägyptischen Künstlerin Bahia Shehab zeigte sie, wie ästhetische Erfahrungen Menschen über alle Grenzen hinweg verbinden können – nicht durch dogmatische Sätze, sondern als geteilte Lebenshaltung.
Abd Ulla schlug in ihrem Essay “The Modern House of Wisdom” einen nach dem Vorbild des Bagdader “Haus der Weisheit” gestalteten interreligiösen Lernort vor. Auf diese Weise könnten die oft konfliktreichen Beziehungen zwischen Muslimen und Christen verbessert werden. Als Säulen des dort praktizierten Dialogs nannte sie u.a. Anerkennung der eigenen Identität, Schaffung sicherer Räume, Respekt für die Würde aller sowie den Kampf gegen Islamophobie. Dies könne entscheidend zu einem friedlichen Zusammenleben beitragen.
Den ersten Platz belegte Jana Viktoria Behrens mit einer empirischen Untersuchung zu Gebetsgesten verschiedener Religionen. In Interviews mit Teilnehmern der Studienwoche erkundete sie deren Bedeutung und Funktion. Häufig genannt wurden die Konzentration auf das Gebet oder die leibliche Strukturierung des Gebetsraums. Die Frage nach der “Lieblingsgebetsgeste” führte oft zu intensiven Gesprächen, in denen individuelle Religiosität zum Ausdruck kam. Behrens betonte, dass Muslime wie Christen zwar unterschiedliche Gesten praktizierten, diese aber oft ähnliche Funktionen hätten. Ihre Methode sah sie als Anstoß für einen fragenden, nicht wertenden interreligiösen Dialog.



In der an die Laudatio anschließenden Podiumsdiskussion wurden zunächst die von Prof. Schulze eingeführten Konzepte befragt, allen voran die Unterscheidung von “Ultrareligiosität” und “Ultranationalismus”. Schulze erläuterte, dass diese Begriffe Phänomene beschreiben, die als Reaktion auf eine tiefgreifende Krise der “normativen Ordnung der Moderne” zu verstehen seien. Gemeinsam sei ihnen die radikale Opposition zur säkularen Gesellschaft und ihren Lebensformen. Der Begriff der “Ultrareligiosität” ziele auf eine Verabsolutierung des Religiösen, die einher gehe mit der Schaffung einer neuen, kaum noch traditionsbezogenen “Orthodoxie”. Dagegen manifestiere sich im “Ultranationalismus” eine Überhöhung der Nation, verbunden mit einer Sakralisierung von Geschichte und Gemeinschaft. Charakteristisch für beide Strömungen sei ihr antipluralistischer, gegen den modernen Verfassungsstaat gerichteter Impuls.
Schulze grenzte diese “Ultraismen” von einem rein religiösen Fundamentalismus ab. Während beim Fundamentalismus die Lebensführung durchaus säkular bleiben könne, sei für ultrareligiöse Strömungen die umfassende lebenspraktische Opposition prägend. Er warnte davor, ultranationalistische Bewegungen vorschnell mit dem Faschismus gleichzusetzen. Zwar gebe es Schnittmengen, jedoch auch entscheidende Differenzen. So sei für den Faschismus der Rassismus und Antisemitismus konstitutiv, während ultranationalistische Bewegungen sich eher über einen exklusiven Volks- und Gemeinschaftsbegriff definierten.
Gefragt nach dem Verhältnis von Ultrareligiosität und Gewalt brachte Schulze erneut den 11. September als “Zäsur” ins Spiel. Die Anschläge hätten eine Radikalisierung markiert, die sich gerade in ihrer Abkehr von der islamischen Tradition manifestiere. Zugleich wandte er sich gegen jede Pauschalisierung. Entscheidend sei, danach zu fragen, unter welchen Bedingungen Religiosität in Gewalt umschlagen könne. Die oft beschworene “Verführungsmacht” der Religion sei jedenfalls kein hinreichender Erklärungsgrund.
Angesichts der Frage, ob nicht gerade solche Phänomene zeigten, dass der interreligiöse Dialog an Grenzen stoße, hielt Schulze entgegen, dass der Dialog als “Gegengift” umso dringlicher sei: Seine Aufgabe sei es, gegen jede Instrumentalisierung von Religion Stellung zu beziehen und zugleich selbstkritisch die eigenen Traditionen zu befragen. Nur so lasse sich der Stimme der “Mitte” wieder Gehör verschaffen.
Kritisch diskutiert wurde auch die Kategorie des “Religionismus” als Analogie zu Nationalismus und Faschismus. Schulze sah darin ein nicht vollständig überzeugendes Konzept, da die inhaltliche Bestimmung letztlich unklar bleibe. Sinnvoller sei es, nach den konkreten Gestalten des “Religiösen” und ihren gesellschaftlichen Wirkungen zu fragen. Gerade mit Blick auf aktuelle Entwicklungen wie den Hindu-Nationalismus in Indien sei eine differenzierte Analyse gefragt, die vorschnelle Generalisierungen vermeide. Zugleich bleibe der kritische Blick auf problematische Allianzen von Orthodoxie und politischer Macht unverzichtbar.

Am Ende stand erneut das Plädoyer für den interreligiösen Dialog als Medium der Verständigung und Selbstvergewisserung. Behrens unterstrich, wie sehr auch ihr eigenes Selbstverständnis als Christin von der Begegnung mit Muslim:innen geprägt sei. Abd Ulla verwies auf das gemeinsame Anliegen einer “Ökologie der Verständigung”. In einer zunehmend polarisierten Öffentlichkeit sei es Aufgabe der Religionen, das Verbindende zu betonen, ohne die Unterschiede zu leugnen. Dies erfordere Modelle eines gelingenden Zusammenlebens in Vielfalt wie auch persönliche Begegnungen, die “Räume der Konvivenz” eröffnen. Nur so könnten Religionen zu Wegbereitern einer friedlichen Zukunft werden. Auch Jana Viktoria Behrens betonte, der Dialog könne dazu beitragen, wechselseitig Vorurteile und Unsicherheiten abzubauen. Er habe damit eine elementare friedensstiftende Funktion gerade in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung. Hanna Morlock ergänzte, dass auch der persönliche Glaube der Beteiligten von der dialogischen Begegnung profitiere: Im Austausch lerne man Wesentliches über die eigene Tradition und entwickle seine Religiosität weiter. Der Dialog wirke so in die Gesellschaft wie in die Religionsgemeinschaften hinein.
Prof. Schulze knüpfte an diese Überlegungen an, mahnte jedoch zugleich die Grenzen eines Dialogs “in der Bubble” an. Entscheidend sei, dass der Austausch sich nicht auf ohnehin dialogbereite Gruppen beschränke. Wichtiger noch als das gegenseitige “Kennenlernen” sei die Identifikation gemeinsamer Problemlagen. Oft zeige sich, dass die Dialogpartner “dasselbe Problem” hätten, auch wenn man bisher vor allem die Differenzen betont habe. Als Beispiel nannte Schulze die Aufforstung als kollektives israelisch-palästinensisches Interesse angesichts der Umweltzerstörung. Hier könnten die religiösen Traditionen als “Ressource” mobilisiert werden, um das gemeinsame Anliegen zu untermauern. Gefragt sei die Fähigkeit, religiöse Argumente auf konkrete Sachfragen zu beziehen. Dafür müssten die Religionsgemeinschaften allerdings zunächst “fit gemacht” werden.
Eine zentrale Herausforderung, darin war sich die Runde einig, bleibe die Reichweite des Dialogs. Zwar ließen sich klare Grenzen gegenüber Extrempositionen nicht vermeiden, doch zugleich sei es wichtig, prinzipielle Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Behrens plädierte dafür, stärker Kompetenzen für den Austausch zu vermitteln, damit Multiplikator:innen wirksamer in ihre jeweiligen Milieus hineinwirken können. Dazu gehöre auch, in strittigen Fällen Position zu beziehen.
Abd Ulla forderte die säkulare Öffentlichkeit zu mehr Offenheit und Lernbereitschaft auf. Ebenso sei auch der innerreligiöse Diskurs in der Pflicht, problematische Entwicklungen klar zu benennen. Nur in diesem doppelten Gespräch nach innen wie nach außen lasse sich eine differenzierte Sicht entwickeln.
Am Ende stand das Plädoyer, die integrative Kraft des Dialogs stärker herauszustellen: Kern des Dialogs sei die wechselseitige Anerkennung als gleichberechtigte Gesprächspartner bei aller inhaltlichen Differenz. Damit sei er nicht nur für die Religionsgemeinschaften selbst relevant. Vielmehr könne der interreligiöse Austausch auch entscheidend zur Stärkung einer pluralen demokratischen Gesellschaft beitragen.
Die diesjährige Studienwoche findet vom 6.-11.10.2024 statt. Interessierte können auf Empfehlung von Hochschullehrenden sich per Anmeldeformular für eine Teilnahme mit Stipendium durch die Eugen-Biser-Stiftung bewerben.
Die prämierten Essays
Die prämierten Essays aus der christlich-islamischen Studienwoche 2023 sind:
1. Jana Viktoria Behrens
2. Hanna Morlock und Randa Abd Ulla
3. Bera Elyesa Topkara
Weiteres zum Veranstaltungskontext auch auf der Akademie-Homepage.