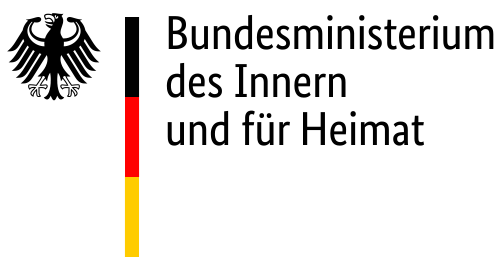Miriam Leidinger befasst sich mit der Frage, wie aus christlich-theologischer Perspektive das Verhältnis von Macht und Geschlecht bestimmt wird. Sie zeigt in einer systematischen Analyse die Genese und Entwicklung feministischer und geschlechtersensibler Theologien seit den 1970er Jahren auf.
Dabei arbeitet sie heraus, dass die Auseinandersetzung mit Machtstrukturen und Geschlechterverhältnissen in der Theologie bereits in den 1970er Jahren begann, angestoßen durch die Frauenbewegung. Damals wurde deutlich, dass die christliche Symbolwelt androzentrisch geprägt ist, wie etwa die Rede von „Gott-Vater“. Radikalfeministische Theologinnen wie Mary Daly zogen daraus den Schluss, die „Männerkirche“ zu verlassen, da „wenn Gott männlich ist, das Männliche Gott“ ist. Andere Theologinnen blieben, um Theologie und Kirche von innen zu reformieren und gründeten ihre Kritik auf historische Frauenfiguren und alternative Gottesbilder.
In einer zweiten Phase rückten intersektionale Perspektiven in den Blick, die Differenzen zwischen Frauen betonen und essentialistische Annahmen einer einheitlichen Kategorie „Frau“ problematisieren. In der dritten Phase ging es um die Dekonstruktion der Zweigeschlechtlichkeit, während heute im Kontext erstarkender Anti-Genderismus Debatten eine „Re-Politisierung der Auseinandersetzung um die Kategorie Geschlecht“ stattfindet. Am Ende ihres Überblicks plädiert Leidinger für einen interreligiösen und interkulturellen Dialog, um „Wegkreuzungen“ für eine gerechtere Welt zu finden.