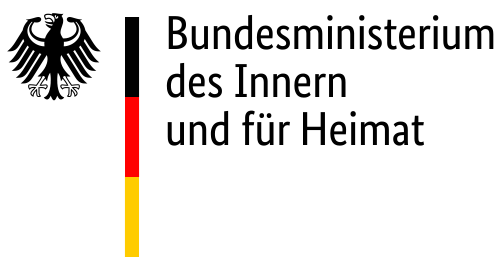Zunehmend häufig ist die Aussage zu vernehmen, Judentum und Christentum „könnten Kritik“, dagegen „der Islam“ jedoch nicht. Dieser hätte, falls überhaupt möglich, erst einmal selbst durch „eine Aufklärung“ zu gehen. Diese Auffassung wird nicht zuletzt auch im Internet sehr häufig von selbsternannten „Islamkritikern“ vertreten, deren Beiträge jedoch inhaltlich und sprachlich eine sehr weite Bandbreite abdecken.
Aus religionswissenschaftlicher Sicht sind solche Essentialisierungen über ganze Religionen und Kulturen hinweg jedoch fraglich. Vielmehr wäre genauer zu fragen: Was genau ist mit „Kritik“ gemeint, tritt sie tatsächlich nur oder vermehrt in bestimmten Kontexten auf – und was wären die empirisch überprüfbaren Gründe dafür?
Über lange Zeiten gelten die islamischen Kulturen dem „christlichen Abendland“ gerade auch im Hinblick auf Bildung und Wissenschaft als überlegen. Erst in der frühen Neuzeit wird in Europa die „Kritik“ zu einer Angelegenheit der breiteren Öffentlichkeit: Der „Kritiker“ ist zunächst ein Literaturkritiker, der sich selbst auf „Vernunft“ beruft und durch eigene Schriftbildung als glaubwürdig ausweisen muss.
Als ab 2011 quer durch die islamisch geprägte Welt hindurch „kritische“ Jugendrevolten (sog. „Arabischer Frühling“) ausbrechen, bemerken Beobachter wiederum die enge Verbindung zur Nutzung neuer Medien: Die Aufstände werden zunächst wesentlich auch als Twitter- und Facebook-Revolutionen wahrgenommen.
Medien sind keine neutralen Informationsvermittler, sie färben Erfahrungen und erzeugen Dynamiken. Auch die Popularisierung von „Kritik“ erweist sich maßgeblich als Ausdruck und Ergebnis von Medienkulturen. Nicht die theoretischen Möglichkeiten der islamischen Theologie an sich, sondern Kontextfaktoren wie etwa die bisweilen schwach ausgeprägte Lesekultur in großen Teilen der islamischen Welt erklären die kulturellen Unterschiede in Bezug auf Erscheinungsformen von und Umgangsweisen mit „Kritik“.