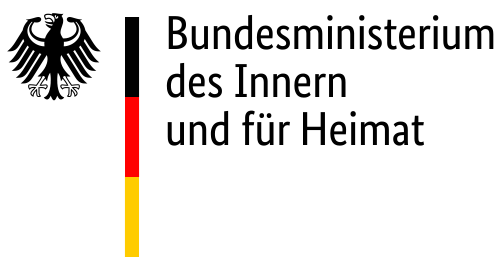Claudia Danzer befasst sich mit der Frage, was katholische Theologie von Rechtsextremismus- und Demokratieforschung lernen kann. Sie geht davon aus, dass katholische Theologie sich als Kritik und Reflexion der eigenen religiösen Praxis verstehen kann und so zur Prävention von Fundamentalismus beitragen kann. Danzer analysiert zunächst die Ergebnisse der Leipziger Autoritarismus-Studie, die zeigen, dass die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen abnimmt, Ressentiments wie Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus aber weiterhin in der Mitte der Gesellschaft bestehen. Sie arbeitet heraus, dass nicht die formale Kirchenzugehörigkeit, sondern das jeweilige religiöse Selbstverständnis entscheidend ist, ob religiöse Menschen anfällig für rechtsextreme Einstellungen sind.
Katholische Theologie und Kirche müssten prüfen, wo sie selbst Ideologien der Ungleichheit und Ungleichwertigkeit vertreten und damit gruppenbezogenes Abwerten unterstützen. Die Diskriminierung von Frauen und LGBTQIA+-Personen in der katholischen Kirche stelle faktisch eine Ungleichbehandlung aufgrund von Gruppenzugehörigkeit dar. Am Beispiel der ablehnenden Haltung des Vatikans zu Genderfragen kritisiert sie, dass die vatikanische Genderkritik wenig Dialogbereitschaft mit der Wissenschaft zeige und einer binären Geschlechteranthropologie verhaftet bleibe. Danzer resümiert: „Will die römisch-katholische Kirche ihren Anspruch erfüllen, für eine lebendige Demokratie einzutreten, muss sie um ihrer Glaubwürdigkeit willen auch sich selbst demokratischer Prinzipien und einer demokratischen Kultur verpflichten.“